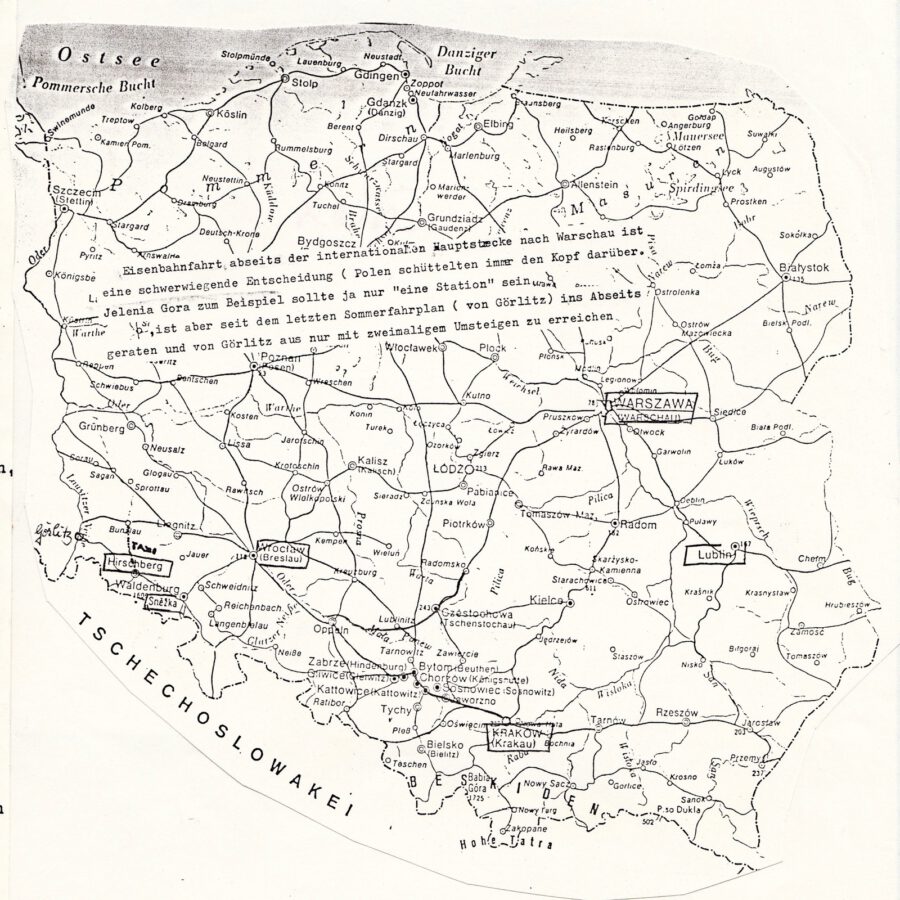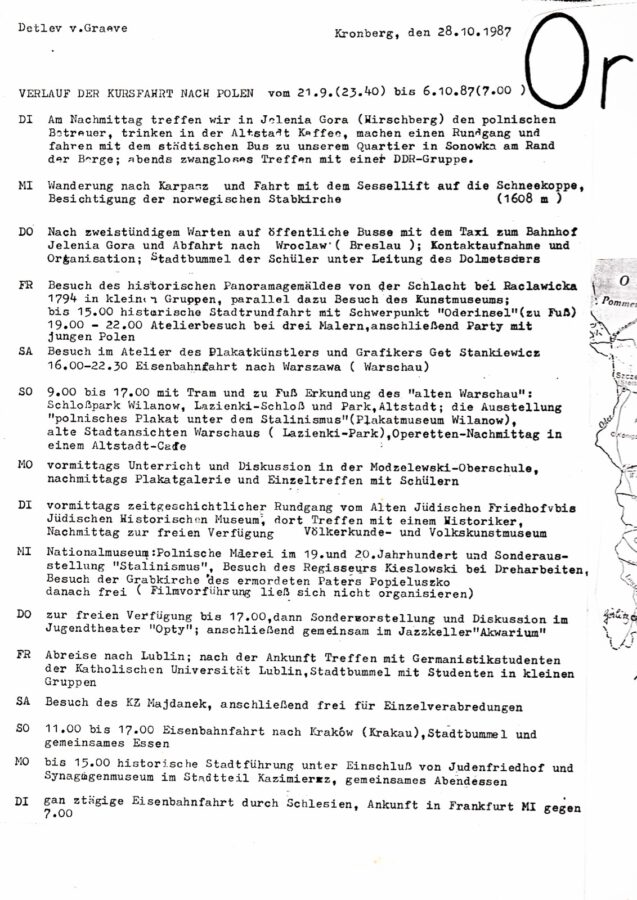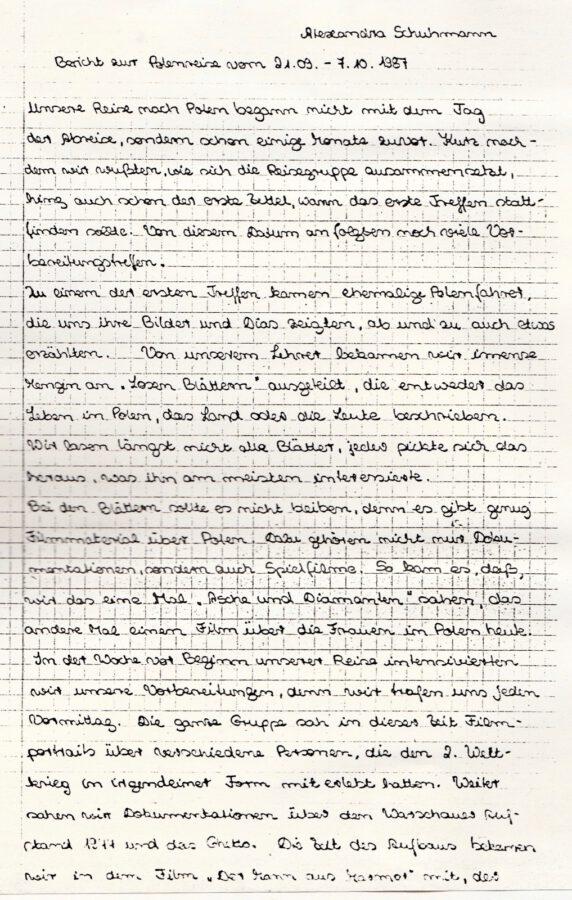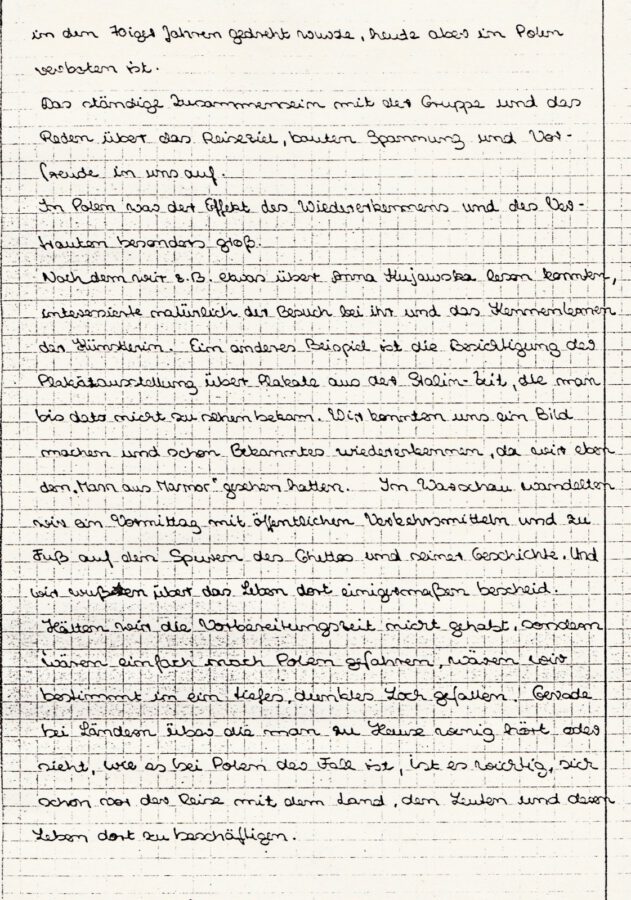Archiv für den Monat: August 2024
Kursfahrt 1987 Ausstellung (Erster Entwurf)
Modellschule und Musterbetrieb – zwei Welten in der Volkrepublik Polen (Reise 1976)
PERSÖNLICHES VORWORT – 20. NOV. 2023
Ich hatte 1973 mit einer geführten China-Gruppenreise eine dreiwöchige Erfahrung gemacht, war also vertraut mit Selbstdarstellung und Eitelkeiten (nicht nur) autoritärer Staaten.
Die Volksrepublik Polen erschien ohnehin als eine andere Welt, eben europäisch. Die DDR kannte ich noch überhaupt nicht. Das kommunistische Projekt gänzlich abzuschreiben, soweit war ich noch nicht, verhielt mich auch gegenüber China abwartend. „Revisionismus“ war bei mir aber unten durch. Anstatt mich an den Spielräumen der Intelligenz zu freuen, nervten mich die Privilegien der Funktionäre, die uns begegneten. >>
Zwei Generationen polnischer Karikaturisten 1976 – z.B. Eryk Lipinski und Andrzej Krauze
VORWORT – AUGUST 2024
Ich hatte 1973 mit einer geführten China-Gruppenreise eine dreiwöchige Erfahrung gemacht; war also vertraut mit Selbstdarstellung und Eitelkeiten (nicht nur) autoritärer Staaten.
Czeslaw Milosz erzählt die Geschichte der baltischen Völker im 20. Jh.
1952 – Unerklärter Kriegszustand – Natürlich wurde die „internationale Zeitschrift“ DER MONAT vom CIA mitfinanziert, so wie „Encounter“ und „Épreuves“ . Natürlich ‚dienten’ Milosz und sein Essay im Kalten Krieg auf amerikanischer Seite und wurden von ihren gebildeten Lesern im Westen entsprechend einäugig gelesen, aber deren Bild von den baltischen Völkern konnte ein paar Retouchen brauchen. – Wir Deutschen des Jahres 2024 tun auch gut daran, uns diese Erfahrungen zu vergegenwärtigen, nicht allein, um die Haltung der baltischen Völker und der Polen besser zu verstehen, sondern vor allem um uns vor Augen zu führen, dass die Hassfigur „Putin“ ein in der langen Zarenzeit entwickeltes repressives System verkörpert, das im zwanzigsten Jahrhundert als ‚Bolschewismus‘ den Staatsterror perfektioniert hat, noch vor dem Maoismus in China.
>>
Große Künstler unterstützen Wiegmann, lese ich bei Zbigniew Herbert und Niklas Maak
Zwei Gelegenheiten für Fritz Wiegmann : 1933…..
Mit Ende Zwanzig war Fritz Wiegmann an einen Punkt gekommen, wo er als Kunstlehrer und populärem Ausstellungsdesign im Team engagierter Sozialmediziner erfolgreich war („Gesunde Nerven“ LINK). Seine kleinformatigen kubistischen Stilleben waren perfekt und erreichten New York (LINK). Er versuchte sich überzeugend in Theaterdekoration (LINK). Von seinen figürlichen erotisch aufgeladenen Kompositionen, die ich in Reproduktion gesehen habe, würde ich das allerdings nicht sagen (LINK später). Lauter Sackgassen im Schicksalsjahr 1933. Und der junge Mann suchte sich Hilfe ‚an höchster Stelle‘, bei den „alten Meistern“.
Ich bemühe mich seit langem, Wiegmanns Ringen um seinen persönlichen Stil nachzuvollziehen. Im bereits früher zitierten Interview des Peiping Chronicle Anfang 1936 beschrieb er seine Situation so:
* Peiping Chronicle 16.2.1936 Ausschnitt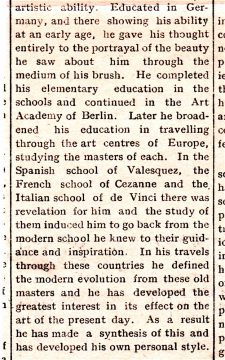
„….. Die spanische Schule des Velasquez, die französischen Schule Cezannes und die italienische da Vincis waren für ihn Offenbarungen. Deren Studium brachte ihn dazu, sich ihrer Führung und Inspiration zu überlassen und der Schule der Moderne, die er kannte, den Rücken zu kehren. Auf seinen Reisen durch diese Länder nahm er die moderne Entwicklung von diesen alten Meistern aus in den Blick, und er entwickelte das größte Interesse an ihrer Wirkung auf die Kunst der Gegenwart. Als Resultat machte er eine Synthese alles dessen und entwickelte seinen persönlichen Stil.“
‚Medizinerblick‘ auf Figuren des Kameruner Graslands (Bamileke) – PLUS
Hochgeladen: 21. Sept. 2022, zweite Erweiterung am 4. Aug, 2024
Mein Vater war ein kunstferner Mediziner der Nachkriegszeit. Manchmal kommen mir bei afrikanischen Figuren seine staubtrockenen Kunstbetrachtungen wieder in den Sinn, zum Beispiel bei den hochgerühmten Karyatidenhockern der Luba mit knienden Frauen. In diesem Fall scheint das medizinisch orientierte Buch „Heil- und Körperkunst in Afrika“ aus dem Linden-Museum ihm Recht zu geben. Der Feststellung einer „Geburtshaltung“ hat meines Wissens kein Kunsthistoriker widersprochen, man redet nur nicht darüber außer in metaphorischer Umschreibung (Neyt und „höfische Norm“ LINK).
Bei dem kleinen hölzernen Charmeur aus Kamerun sind grotesk übertriebene körperliche Eigenheiten nicht zu übersehen. Wieder konsultiere ich Hermann Forkls Buch. Die persönliche Kontaktaufnahme mit dem Gelehrten im Ruhestand versemmele ich leider durch Ungeschick. So bleiben meine Fragen unbeantwortet bis das Archiv der „Basler Mission“ mich zu dem mittlerweile hochbetagten Missionar im Ruhestand Dr. h.c. Hans Knöpfli vermittelt, der lange Jahre unter den Menschen im Kameruner Grasland gelebt und gearbeitet hat. 19.9.2022 >>
Zum Beispiel ‚Mambila’ – Wieso gebe ich mich jetzt mit der ‚Provenienz’ zufrieden?
Geschrieben am 28.1.2020
Manchmal ist die Herkunft, also die Region, wichtiger als die Funktion einer Figur oder Maske. Die Ermittlung ritueller Funktionen ist ohnehin zwischen Erbsenzählerei und Utopie angesiedelt. Als ich heute Zeitlyns Protokolle der Sua-Rituale unter den Mambila las, bewunderte ich seine Gedächtnisleistung, vergaß aber nicht, welche Rolle das kleine Tonbandgerät gespielt hatte und was es registrieren konnte.
Die Herkunft, besonders ‚die Ethnie’, ist für ‚Stammeskunst’ und ihre Vermarktung auf jeder Ebene der wichtigste Anker. Und über einen ‚Anker’ pflegt man nicht weiter nachzudenken.
‚Herkunft’ ist aber auch Heimat. Was in solchen Heimaten passiert, ist oft sehr langweilig, einfach ‚mehr desselben’ (Watzlawik). Von Vilém Flusser habe ich gelernt, auf die ‚Sakralisierung’ von Banalem zu achten und die ‚Familiengeheimnisse’, von denen zahllose ‚Tatort’folgen leben, ironisch zu betrachten. Aber die Heimat selber scheint ihren Zauber – vielleicht in der Art einer Fatamorgana – unbeschadet zu bewahren.
Ich erfahre zum Beispiel über die Objekt-Recherche einiges über die Leute, die sich Mambila nennen, wenn auch die gebotenen Informationen weniger aktuell sind als Angebote bei Google, oft dreißig, vierzig Jahre alt – da war ich selber noch jung. Ich erfahre vieles über die Leute und sehe sie in ihren und jetzt ‚meinen’ Figuren verkörpert. Die sind ja anwesend wie Besucher. Und wie viel will man eigentlich über Besucher wissen? Wo sich doch so viel an Wünschen und Problemen nur wiederholt: Ach ja? Impotenz? Unfruchtbarkeit? Da gibt es doch Angebote! Denken Sie eher an einen traditionellen Heiler aus Afrika oder eine Implantation, oder eine Leihmutter? Beziehungskonflikte? Verhaltenstherapie oder systemische Paartherapie? Ehrlich, wen interessiert das außer die Betroffenen, ihre Verwandten, ihre Freunde oder kommerziell therapeutische Dienstleister?
Die Region und ihre Kultur sind interessanter. Schließlich könnten wir sogar dahin auswandern. Und über die Chancen exotischer Heilkuren sollte man sich informieren.
Freilich kommen ‚künstlerische’ Stammesobjekte meist aus einer praktisch nicht einholbaren Vergangenheit. Sie verkörpern diese, jetzt kraftlos oder von den Verkäufern bewusst ‚entschärft’.
Warum nicht? Nostalgie kann Trost spenden.