Zitat aus dem Flyer (Signalfarbe original):
 Achtzig Hauptwerke afrikanischer Skulptur aus dem verblichenen Ethnologischen Museum sind zu Gast im Bode-Museum. Kunst aus West- und Zentralafrika trifft auf Meisterwerke aus Italien und Mitteleuropa. Im direkten Dialog geht es um die großen Themen der Menschheit: Macht und Tod, Schönheit und Identität, Gerechtigkeit und Erinnerung. AMEN
Achtzig Hauptwerke afrikanischer Skulptur aus dem verblichenen Ethnologischen Museum sind zu Gast im Bode-Museum. Kunst aus West- und Zentralafrika trifft auf Meisterwerke aus Italien und Mitteleuropa. Im direkten Dialog geht es um die großen Themen der Menschheit: Macht und Tod, Schönheit und Identität, Gerechtigkeit und Erinnerung. AMEN
In beiden Hauptetagen des Bode-Museums werden punktuell Skulpturen beider Kontinente gegenübergestellt. (…) Die experimentellen Gegenüberstellungen thematisieren mögliche Zusammenhänge auf verschiedenen Ebenen, beispielsweise historische Zeitgenossenschaft, inhaltliche und technische Gemeinsamkeiten oder künstlerische Strategien.(….)
– ?
– War da noch eine Wortmeldung?
– Ja, ich möchte mein wachsendes Unbehagen artikulieren.
Je länger, desto verstörender
Je länger, desto verstörender ist für mich der unvermittelte Einbruch des Fremden in ein Dutzend auf Epochen bezogener Räume auf zwei Etagen eines gediegenen Museums für alteuropäische Skulptur. Der Museumsplan hebt sie auch noch farblich heraus, ‚dass man einfach mit muss‘ (Volkslied)
Für mich selber sind die exotischen Gäste alte Bekannte; wir kommen sofort ins Gespräch. Sie wirken hilfsbedürftig und irgendwie verloren. Die Paarungen wurden wohl mit der Lostrommel vorgenommen. Poster, Ikon und Flyer spielen unübersehbar mit dem Choc.
Was als direkter Dialog ausgegeben wird, ist im Einzelfall harte Konfrontation. Mit ein paar dürren Worten wird der Gast vorgestellt. Unübersetzbare Bildsprachen kann aber der Blick des Laien nicht überbrücken. Der Audioguide – mit heißer Nadel gestrickt – walzt nur den Tafeltext aus, reine Zeitverschwendung.
Die Gäste sind auch nicht zu Gast, außer im Schönsprech der Ausstellungsdesigner. Sie haben mit der Museum Dahlem ihren Kontext, die Gemeinschaft ihrer Familie, Brüder und Schwestern verloren, wo sie ihre Eigenständigkeit leben konnten. Und das tut man ‚Afrikanern‘ an!
In Wahrheit sind sie fehl am Platz, ‚Displaced Persons‘, die nun an verschiedenen Spielstätten anlanden und für kurze Zeit in gleißendem Rampenlicht stehen, als Kunstwerke, ja Hauptwerke angepriesen.
Kunstkammer
Manche sollen vor Jahrhunderten bereits gemeinsam in der Brandenburgisch-Preußischen Kunstkammer (ge)standen haben. (Flyer) Das müssen goldene Zeiten gewesen sein, denn bei der Trennung im 19. Jahrhundert endeten viele Objekte aus Afrika als völkerkundliche Anschauungsobjekte. (Ebd.) Daraus befreit sie nun endgültig das Management der Staatlichen Museen zu Berlin (SMB). Was aus dieser Zeit als Hundemarke etwa auf dem Rücken angebracht wurde, bleibt natürlich stehen, dank deutscher Gewissenhaftigkeit.
Kunstkammer (ge)standen haben. (Flyer) Das müssen goldene Zeiten gewesen sein, denn bei der Trennung im 19. Jahrhundert endeten viele Objekte aus Afrika als völkerkundliche Anschauungsobjekte. (Ebd.) Daraus befreit sie nun endgültig das Management der Staatlichen Museen zu Berlin (SMB). Was aus dieser Zeit als Hundemarke etwa auf dem Rücken angebracht wurde, bleibt natürlich stehen, dank deutscher Gewissenhaftigkeit.
Für experimentelle Gegenüberstellungen ist der Schauplatz eines konventionellen Museumssaals ungeeignet. Experimentell war die Sache nur für die Macher. Das Publikum darf nicht mitspielen, etwa mit einem kongolesischen Fetisch ins europäische Mittelalter verschwinden oder die jeweils gebotenen Mutterschafts-Darstellungen austauschen. Man kann auch nicht den ganzen Spuk für eine gewisse Zeit wieder verschwinden lassen.
Als seien die meisten Besucher, denen bekanntlich in der Schule europäische Geschichte brutal zusammengestrichen wurde, von den vielen Epochen, Stilen und Themen nicht schon genug gefordert, sollen sie nun auch noch wie auf einem Suchbild das Fremde identifizieren, dann begreifen und schließlich frei spekulierend in mögliche Zusammenhänge versetzen, während der Guide im Ohr labert.
Da die gemeinsame Präsentation im Bode-Museum als Morgenröte einer neuen Nachbarschaft im Humboldt Forum ausgegeben wird, sei noch eine Besorgnis geäußert: Dass die großen Themen der Menschheit von nun an für Mehr und Mehr und ‚Mehr desselben‘ den Vorwand abgeben müssen.
Damit sind wir nun endlich bei ästhetischen und inhaltlichen Aspekten der Migration afrikanischer Kunst in die Schatzkammer untergegangener europäischer Kunsttraditionen im Hause Bode.
Man tut den vorgeführten ‚ Afrikanern‘ mit der Gegenüberstellung keinen Gefallen.
 Nur einmal überstrahlt eine afrikanische Skulptur die europäische: eine bronzene Leoparden-Aquamanile aus dem Königreiche Benin (Nigeria, 17. Jh.) distanziert das honorige Löwen-Gefäß aus Niedersachsen (um 1500). Der geniale Realismus des ‚Leoparden‘ speist sich gleich aus mehreren Quellen: der Beobachtung und einer sprichwörtlichen Hochachtung für dieses herrschaftliche Tier. (Link) Der direkten Gegenüberstellung steht zwar eine breite Treppe im Wege, aber die innere Verwandtschaft ist bereits durch die gleiche Funktion (Handwaschung) und die gemeinsame Herkunft dieses Gerätetyps aus dem Orient gegeben.
Nur einmal überstrahlt eine afrikanische Skulptur die europäische: eine bronzene Leoparden-Aquamanile aus dem Königreiche Benin (Nigeria, 17. Jh.) distanziert das honorige Löwen-Gefäß aus Niedersachsen (um 1500). Der geniale Realismus des ‚Leoparden‘ speist sich gleich aus mehreren Quellen: der Beobachtung und einer sprichwörtlichen Hochachtung für dieses herrschaftliche Tier. (Link) Der direkten Gegenüberstellung steht zwar eine breite Treppe im Wege, aber die innere Verwandtschaft ist bereits durch die gleiche Funktion (Handwaschung) und die gemeinsame Herkunft dieses Gerätetyps aus dem Orient gegeben.
Das ganze Bode-Museum steht voll von Kunst eines veredelten ‚Naturalismus’ in der Tradition der griechischen Antike. Wie kann ein punktuell abgeworfenes Werk anderer Bildsprache sich dagegen behaupten?
der griechischen Antike. Wie kann ein punktuell abgeworfenes Werk anderer Bildsprache sich dagegen behaupten?
Die Stücke wirken buchstäblich mangelhaft, so wie etwa die flache Scheibe einer Akuaba aus Ghana gegen einen Christusknaben, den man knuddeln möchte oder der breit geschlagene kupferne Schlangenkopf Bwiti (Kota) gegen den wie in einer Momentaufnahme erfassten und geschminkten Kopf eines Bischofs im Goldornat (Reliquienbüste) aus Belgien um 1520.
- 1520? Das war doch eine selbstbewusste, wenn nicht arrogante Demonstration der Kirche unter den Habsburgern gegen die anrollende Reformation!
- – Und dem steht ein Familienerbstück gegenüber. Was soll denn daran vergleichbar sein?
- – Die Knöchelchen im Innern, Dummkopf!
Um ehrlich zu sein, manchmal sind als Hauptwerke – eigentlich Meisterwerke – ausgezeichnete Stücke serielles Kunsthandwerk, wie viele Bronzen aus Benin.
Die Bronzen aus königlichen Werkstätten Alt-Nigerias boten sich natürlich für das Unternehmen direkter Dialog an. Standen sie doch schon damals über den Atlantikhandel in regem Austausch mit Europa, manchmal wurde auch die Bronze geliefert. Aber Hauptwerke kamen selten vor, dafür war der Bedarf der Könige an diplomatischen Geschenken zu hoch.
 Um eine große Kraftfigur der Yombe (Mangaaka, Kongo-Brazzaville) macht man großes Aufhebens. Sie wird einer Maria mit dem Schutzmantel (Michel Erhard, Ulm um 1480) beigeordnet. Irgendwo lese ich, dass die christlichen und afrikanisch magischen schützenden Strategien kontrastieren. Das kann man wohl sagen! (ein Link reicht nicht als Kommentar)
Um eine große Kraftfigur der Yombe (Mangaaka, Kongo-Brazzaville) macht man großes Aufhebens. Sie wird einer Maria mit dem Schutzmantel (Michel Erhard, Ulm um 1480) beigeordnet. Irgendwo lese ich, dass die christlichen und afrikanisch magischen schützenden Strategien kontrastieren. Das kann man wohl sagen! (ein Link reicht nicht als Kommentar)
Wichtiger ist hier aber etwas anderes: Die Madonna ist in sehr gutem Zustand. Die Kraftfigur ist eine Ruine. Wie Alisa Lagamma (Link) und Wyatt MacGaffey (Link) gezeigt haben, macht zum einen die Ausstrahlung eines solchen Fetisch einen beträchtliche Teil der Wirkung aus, zum andern hat man die Figuren bei der Abgabe an die Fremden nach Möglichkeit entladen, manchmal auch wieder aufgehübscht, etwa mit einer Extraportion alter Nägel und Eisen. Diese Figur besaß sichtlich früher Backenbart und Schurz, nun stecken Nägel an der Stelle des Bartes.
Die vielen Kraftfiguren – auch kleine schöne darunter – sind alle zwischen 1890 und 1900 von einem Plantagenmanager, Robert Visser, und ähnlichen Leuten an der Kongo-Küste zur Ausstattung der neuen Museen im Deutschen Reich besorgt worden. (Lit.: Grassi-Museum Leipzig, „Minkisi“ 2012) Deren afrikanische Handelspartner waren nicht dumm. Sie belieferten gern den Geschmack der Weißen an grusligen Fetischen und finsteren Reliquarfiguren, zum Beispiel auch die glotzende schwarze Reliquarfigur der Fang in Gabun. Sie wird hier übrigens mit einer toskanischen thronenden Muttergottes von 1199 gepaart.
- – Wow! Aber dürfen wir uns heute noch Phantasien erlauben?
- – Der direkte Dialog muss seine Grenzen kennen. Zum Beispiel die des guten Geschmacks.
Aber ….
 Aber die afrikanische Verherrlichung der Mutterschaft! Die Bedeutung der Familie – hier in einem Fall mit einer Darstellung der gesamten dynastischen Sippe der Gottesmutter Maria konfrontiert! Ein witziges ‚allzumenschliches‘ Bild! Die Macht der Ahnen, das Leiden der Menschen, Schmerzensmänner und der Gekreuzigte…. Das alles verdient nähere Betrachtung.
Aber die afrikanische Verherrlichung der Mutterschaft! Die Bedeutung der Familie – hier in einem Fall mit einer Darstellung der gesamten dynastischen Sippe der Gottesmutter Maria konfrontiert! Ein witziges ‚allzumenschliches‘ Bild! Die Macht der Ahnen, das Leiden der Menschen, Schmerzensmänner und der Gekreuzigte…. Das alles verdient nähere Betrachtung.
Übrigens: Die Zusammenstellung ganzer Gruppen im Sonderausstellungsraum im Keller für thematische Vertiefungen ist die bewährte Alternative. Etwas schäbig, aber da geht etwas.
Methodische Oberflächlichkeit produziert dagegen schiefe Vergleiche und falsche Vorstellungen am laufenden Band. Der Nagel im Fleisch Christi und der Nagel im Holz des waffenstarrenden Fetisch haben auf der Bedeutungsebene nichts miteinander zu tun, selbst wenn die formale Idee oder sogar die Eisennägel aus Europa importiert sein sollten.
Typisch taz ?
Da passt es ja, dass ich die Ausstellung gerade google. Unter der Überschrift „Debatte ums Humboldtforum – Wer ist wir? Die neue Ausstellung „Unvergleichlich: Kunst aus Afrika im Bode-Museum“ zeigt, wie Museen selbstkritisch mit ihren Sammlungen umgehen können – wenn sie wollen“ schreibt die taz im bekannten Jammerton über was wohl: „Die Benin-Kunst – Ein Paradebeispiel für Raubkunst“. (Link) Dafür muss man überhaupt keine Ahnung von der Sache haben, nur dem Kurator lauschen und die ‚Nummer auf dem Rücken‘ andächtig begucken. Natürlich wird die bislang ausstehende Rückforderung aus Nigeria erfragt. Was würde die erst für eine tolle Reportage abgeben! Nigeria klingt einfach gut. Dazu muss man weder etwas von der famosen Korruption im Land wissen, noch über die innenpolitische Rolle derartiger Benin-Plastiken im Land nachlesen – etwa bei Sylvester Okwonudu Ogbechie: ‚Making History‘, 2011 (Link) . Ein praktischer Vorschlag vorab: die ‚Originale‘ vorsorglich gegen von der Zunft ab 1898 nachproduzierte Stücke austauschen. Merkt doch keiner. Benin-Prinz Ogbechie könnte gewiss vermitteln. („Taz.zahl ich“ – Nee!) 8.11.17
Falsche Höflichkeit
Dass Afrikaner ebenso leiden können wie wir, dass sie Ängste haben, Schutz suchen, Familie haben, repräsentieren wollen, ehrgeizig, eifersüchtig, neidisch sind und anderen schaden wollen, sollten wir ohnehin annehmen, auch ohne große Themen.
Hier zeigt sich auf dumme Art eine gewisse Höflichkeit der Ausstellungsmacher gegenüber den Gästen. Man will sie ja nicht bloßstellen und blendet die ‚dunklen‘ Bereiche afrikanischer Traditionen nach Möglichkeit aus. Man idealisiert zum Beispiel auf altfeministische Art die Bedeutung der Erbfolge der mütterlichen Linie. Die soziale Macht lag und liegt bei den Männern und generell bei den Alten. Der Geist der legendären Klan-Mutter stand und steht nicht auf der Seite der jungen Männer und noch viel weniger der jungen Frauen. Alle wissen das, nur wir sollen kein Aufhebens davon machen. Auch der Schadenszauber ist mehr denn je ein soziale Seuche in ganz Afrika. ‚Kraftfiguren‘ aus ambivalentem (‚dual – use‘) Kontext sind in der Ausstellung, vor allem im Keller, zahlreich vertreten. ( Dazu: S. Preston Blier „African Vodun“, 1995 : Link)
Frischer Blick auf eine Madonnenfigur
Die neue Inszenierung im Bode-Museum bietet natürlich die Chance zu positiven Erfahrungen. Ich schaue heute auch alteuropäische Figuren anders an, genauer, so zum Beispiel die ‚Löwen-Madonna‘ aus Salzburg um 1350. Ich wüsste auch passende afrikanische Partner(innen), leider hat sie keine bekommen.
Gleich fällt mir die viel zu große Hand auf und der sichere Halt, den die dem Kind bietet.
Ich nehme die Bemalung der Figur wahr und ihre Dynamik, die auch mit dem Grenzen setzenden Holzdurchmesser zu tun hat.
Daher und entsprechend seiner Bedeutung ist der Löwe verkleinert . Es könnte auch ein Fels sein.
Marias Hüfte ist nach der Seite verschoben, dass das Baby darauf sitzen kann.
Noch mehr Entdeckungen vermittelt die ausführliche Schrifttafel: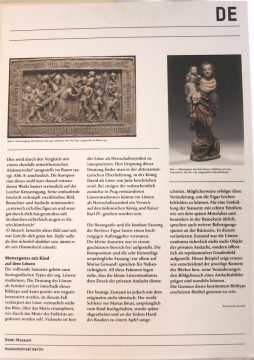
Danach ist der Löwe wohl als Herrschaftssymbol zu interpretieren – keine Frage: ‚afrikanisch‘
Die kleine Löwenmadonna diente wohl der privaten Andacht einer hochrangigen Persönlichkeit. Im geschützten Bereich frei aufgestellt war sie für eine Nahansicht konzipiert. – Das könnte auch von einer Mutter-Kind-Dastellung der Yombe am Kongo gesagt werden. ‚Andacht‘ ist ein weites Feld.
Dann ist von Umarbeitung – „um die Figur leichter bekleiden zu können“ – im Barock für eine Umwidmung zu einem repräsentativen Gnadenbild die Rede. Und dann folgt der Schlußsatz, der für afrikanische Figuren häufig zutrifft: „Die Grenzen dieses bestimmten Bildtyps scheinen flexibel gewesen zu sein.“
Erhaltungszustand und Patina
Wenn eine Figur in Afrika Aufmerksamkeit schon bei der Bestellung genossen hat und Zuwendung und Pflege über angemessene Zeit hinweg bekam, wird sie mühelos einen Vergleich bestehen mit den zahlreichen alten europäischen Figuren aus Wohnräumen, Kapellen, Kirchen und Palästen.
Oder war sie Wind und Wetter ausgesetzt, etwa an den verschiedensten Orten als Wächter? Oder wurde sie irgendwann als überflüssig oder gar störend in einem ‚Heiligen‘ Hain sich selbst überlassen? Oder versah sie nur kurze Zeit ihren Dienst oder wurde sogar direkt für den Export hergestellt? Auch ein ganzes Jahrhundert im Museumsdepot kann ihre ‚Mängel‘ nicht ausgleichen. Restauratoren dürfen heute ja auch nur den erreichten Zustand konservieren, keinen bloß erwünschten herstellen. Die Figur ist älter geworden, weit über ihren ursprünglich veranschlagten Zeithorizont hinaus, ohne ‚Aura‘ zu gewinnen. Einem leblosen Veteranen ziehe ich als Sammler auch viel jüngere persönliche ‚Andachts’figuren oder Erbstücke – das können auch Masken sein – vor.
Wenn so ein abgewitterter Veteran in klassische Kunstmuseen gebracht wird, scheitert er. Der Louvre in Paris hat auf langes Drängen des Sammlers und Experten Jacques Kerchache vor Jahren afrikanische und ozeanische Kunst aufgenommen, in einem eigenen großen und hellen Saal ganz am Ende des Schlosses. Als ich mich endlich durchgefragt hatte, war ich sehr enttäuscht von der schwachen Wirkung der ‚Objekte‘. Ich schrieb darüber einen Beitrag: „Afrika in Paris : Louvre und Quai Branly“ (Link). Die ziemlich zeitgleiche Entscheidung, am Quai Branly ein eigenes modernes Haus für die Stammeskunst der Welt zu bauen, war die bessere Entscheidung.
Vielleicht sollte für eine Fortsetzung, für die neue hybride Weltkunst in den bekannten Recycling-Materialien der tropischen Weltmetropolen ein weiteres schönes Haus errichtet werden. Sie findet bisher nur in kleinen Sonderausstellungen den Weg zu uns. Lasst die Heuchelei in repräsentativer Umgebung, lasst das Schönreden angeblicher Hauptwerke von irgendwoher!
Verlangst du etwa Schonräume?
Was machst du da? Du plädierst doch nicht für Schonräume, ‚Biotope‘ innerhalb einer entfesselten Globalisierung ?? Alle ‚Kulturgüter kommen jetzt in genau dieselbe Sphäre, in der sich die übrigen Konsumgüter bereits befinden, und übrigens nicht nur sie, sondern auch ihre Produzenten. Dank Solarstrom schauen tibetische Nomaden, die letzten, chinesische Unterhaltungsshows per Satellit (Genevieve Brault: „Tibet- Meines Vaters Land“ ARTE, 25.9.2017).
Verrat!
Die professionellen Bewahrer und Fürsprecher traditioneller Kulturen verraten ihre Mündel, putzen sie zu ‚Schaustücken‘ auf. Jedes muss gegen jedes andere antreten. Presseschlagzeilen lassen das erahnen: „Schutz-Krieger aus Afrika trifft Maria aus Berlin“ (BZ-Berlin) oder „Die Madonna und der Nagelmann“ (Tagesspiegel). In diesem Prozess werden sie zurechtgeschliffen, umformatiert, damit sie sich immer neu vernetzen lassen. Was an mythologischen Resten an ihnen haftet, lässt sich portionsweise aktivieren. Was muss das Volk über Nagelfetische wissen? Heute bietet der Museumsdirektor Julien Chapuis, fachlich nicht ganz zuständig, folgende spritzige Story: “ Wenn ein Vertrag oder ähnliches geschlossen wurde, trieb man einen Nagel ins Holz. Wurde die Vereinbarung gebrochen, zog man ihn hinaus. auf dass der Mangaaka sich räche.“ (O-Ton BZ). Klingt plausibel, aber in anderen Fällen de-aktivierte man den Fetisch auf diese Weise. Eigentlich egal. Morgen hören wir eine neue Erklärung.

