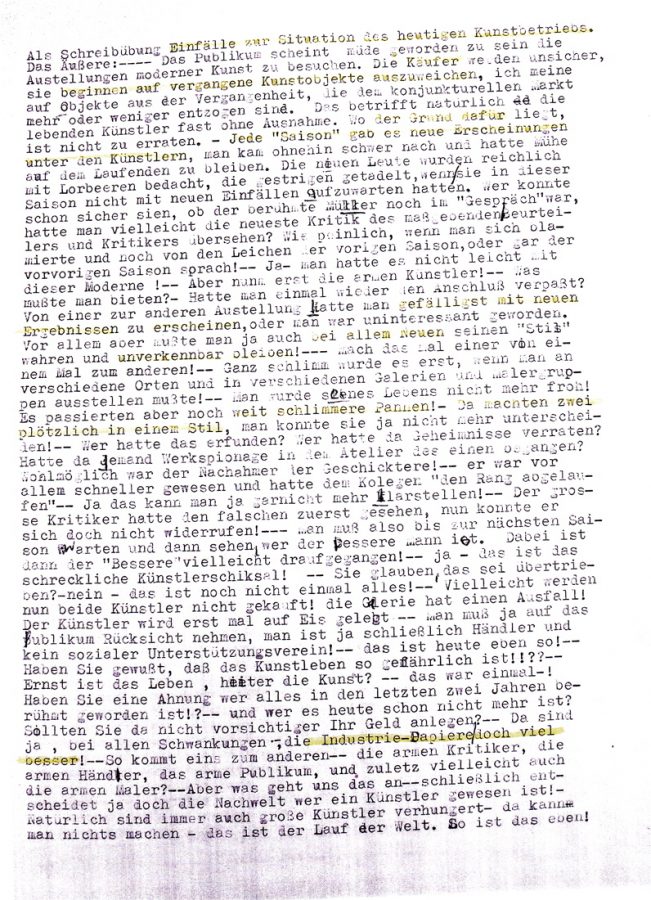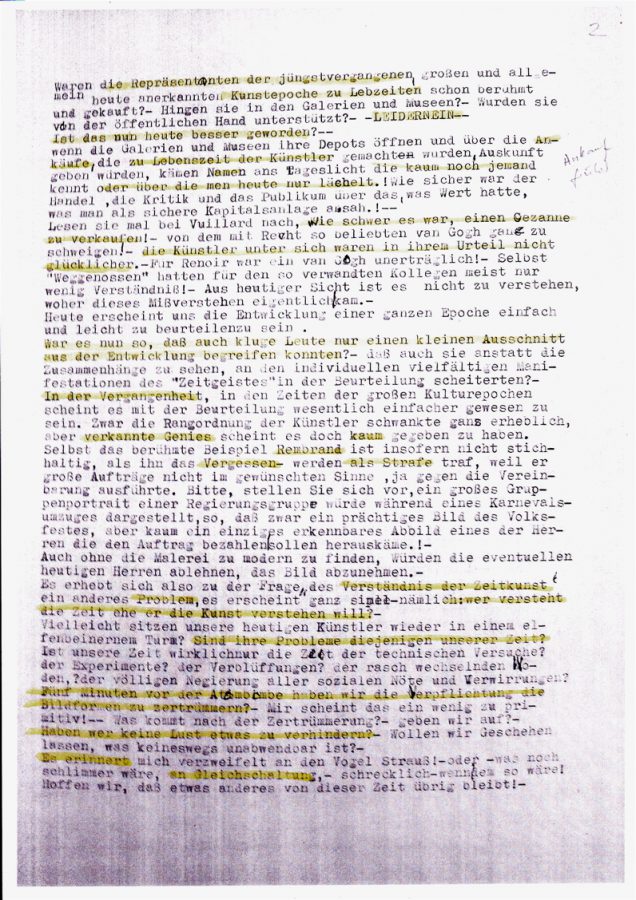Im Nachkriegsdeutschland fasste Wiegmann als Künstler nicht Fuß, zumal der Schuldienst eine Menge Kraft kostete. Nach seiner Pensionierung hatte er noch zehn Jahre für eine Malerei unabhängig vom Zeitgeist. Ob er dabei an die entpflichteten Mandarine des kaiserlichen China dachte?
Eins der Themen für seine Übungen an der Schreibmaschine war „Kunstbetrieb“. – Ich habe den Text auf meiner Kopie gemarkert.
30.10.2016
Bei allem Verständnis für die „ersehnte freiheit – abstraktion in den 1950er Jahren“ ….
Das Museum Giersch, Frankfurt/Main zeigt noch bis 9.7.2017 in einer konzentrierten Schau abstrakte Nachkriegskunst in Westdeutschland der fünfziger Jahre. Das Gefühl großer Befreiung der Beteiligten weht einem entgegen. So kam mir der Aufbruch in Sellos Hamburger Galerie 1945 bis 1951 spontan wieder in den Sinn.
Das lange Verbotene mitten unter den ‚entnazifizierten‘ Reichsdeutschen tun zu können, auch wenn man sich in kleinen verschworenen Gruppen in Zimmer-Galerien traf. Damit irgendwie auch politisch ‚erwünscht’ zu wirken, den Rückenwind der Reeducation all dieser tumben Volksgenossen zu spüren. Sobald man konnte, reiste man ins Ausland, um Anschluss an die neuesten Trends zu suchen.
Die Chance zum Neuanfang – mancher hatte ohnehin alles verloren, Atelier und Arbeiten – aber Avantgarde? Willi Baumeisters oft gezeigtes „Phantom mit roter Figur“ zum Beispiel wirkt an der Wand spontan wie ein Miro. (Flyer Mitte oben)
Dazu kam die ideologische Frontbildung im Klima des Kalten Kriegs! Der Streit um den „Verlust der Mitte“ (Sedlmayer) wurde emotional und heftig ausgetragen.Die Ausstellung fokussiert sich auf die Alternative „gegenständlich“ oder „abstrakt“. Eine ärmliche Alternative: Erstere ist in der Schau bloß durch zwei Ölbilder Carl Hofers in steifer kreidiger Gegenständlichkeit vertreten.
Die Lektüre des „Dilettantismus“-Artikels aus Wiegmanns Nachlass war mir noch präsent:
Carl Linfert diagnostizierte 1931 eine ‚strukturelle’ Krise der modernen Kunst, wobei sich seit dem frühen 19. Jahrhundert verschiedene Krisen ablösten. Ich resümiere :
- Sozialer Bedeutungsverlust durch Absonderung im „entrückten Kunstbezirk“ seit dem 19. Jahrhundert
- Imme neue Programme und Parolen
- Der verursachte Verlust vieler tradierter Kunstmittel
- Eine sich allmählich entleerende abstrakte Kunst
Hatte die Situation sich inzwischen nicht verschlimmert? Bereits Linfert sprach von einem ‚naiven’ Primitivismus’. Der erhielt mit jeder neuen Generation einen frischen Schub.
Was thematisiert davon Wiegmann in seiner ‚Schreibübung‘ ?
- ein des ewigen Wechsels müde gewordenes, abgestumpftes Publikum.
- den Druck auf die Künstler, durch die jeweils aktuellen Beurteiler und Kritiker‚im Gespräch’ zu bleiben (Dokumenta-Fotos mit lesenden Besuchern!) und denen mit neuen Einfällen zu gefallen. Wiegmann spricht vom Anpassungsdruck der diversen ‚Malergruppen’ und Galerien
- Er thematisiert die Angst vor Werkspionage : Womöglich war der Nachahmer der Geschicktere.
- Wiegmanns Beispiele unglücklicher Lebensverläufe und Fehlurteile entstammen bewusst sämtlich dem 19. Und 20. Jh.! Für die Epochen davor schreibt er: Verkannte Genies scheint es doch kaum gegeben zu haben. Das zu erwartende Gegenbeispiel Rembrandt entkräftet er nüchtern als Selbstschädigung durch unmögliches Geschäftsgebaren.
- Mit dem Folgenden wird er viel konkreter als Linfert, der nur von ‚Absonderung’ sprach. Politische Erfahrungen will Wiegmann nach Diktatur, Krieg und ‚Kaltem Krieg‘ nicht mehr bloß vornehm andeuten: Bevor man mangelndes Verständnis der Zeitkunst’ beklage, solle man fragen: Wer versteht die Zeit, ehe er die Kunst verstehen will? Er fragt weiter : Sind ihre Probleme diejenigen unserer Zeit? Als individuelle Trauma-Kunsttherapie oder als Spiel (post-)pubertärer Jugendkultur, wie sie mir jetzt im Horizont der Ausstellung ‚Ersehnte Freiheit’ erscheint, will er ‚Kunst’ nicht gleichsetzen.
Er wird konkreter und scheint mir damit unverändert aktuell:
- – Ist unsere Zeit nur die Zeit technischer Versuche? Der Experimente? – So wie das Flusser als einziges relevantes Paradigma sehen wollte. Ein Zurückschrecken sollte nicht erlaubt sein, wurde verhöhnt, vielleicht weil das der endgültigen ‚Shoa’ der gesamten Menschheit im Weg stand.
- – ‚…. der Verblüffungen? Der Moden? Der völligen Negierung aller sozialen Nöte und Verwirrungen?’ – ‚Kunst’ als Teil der Luxus(industrie) und Ignoranz, wie sie für mich immer noch gültig in Huxleys Roman „Brave New World“ (1932) verkörpert wird.
- – Fünf Minuten vor der Atombombe haben wir die Verpflichtung, die Bildformen zu zertrümmern? Was kommt danach? …. Keine Lust etwas zu verhindern?
- Und schließlich: Gleichschaltung. – Der nach Hitler und angesichts der Positionierung gegen die Kunst der ‚DDR‘ härteste Vorwurf! Er meint aber, was er im Gespräch „Galerieknechte“ nannte. Wir denken heute an Diktate des Kunstmarkts. (Mai 2017)