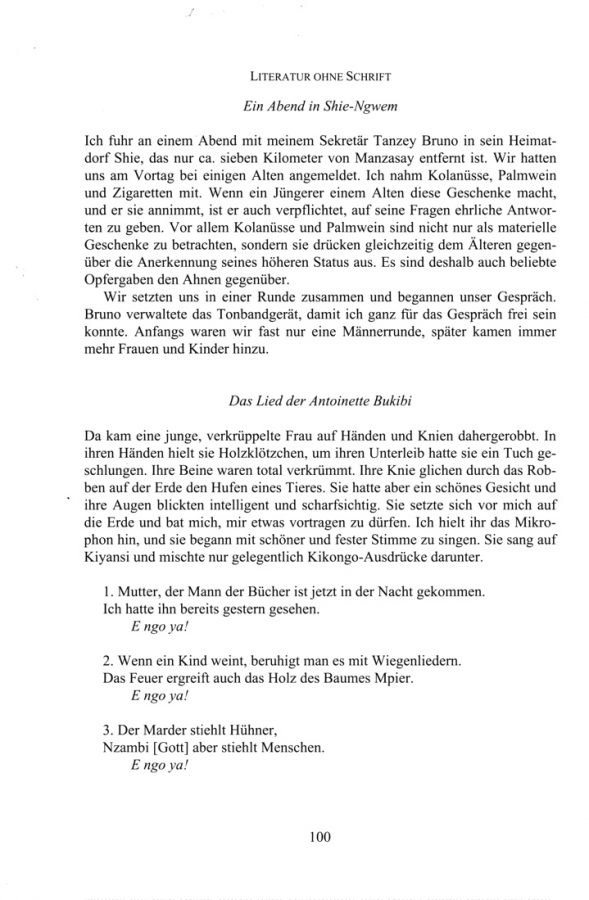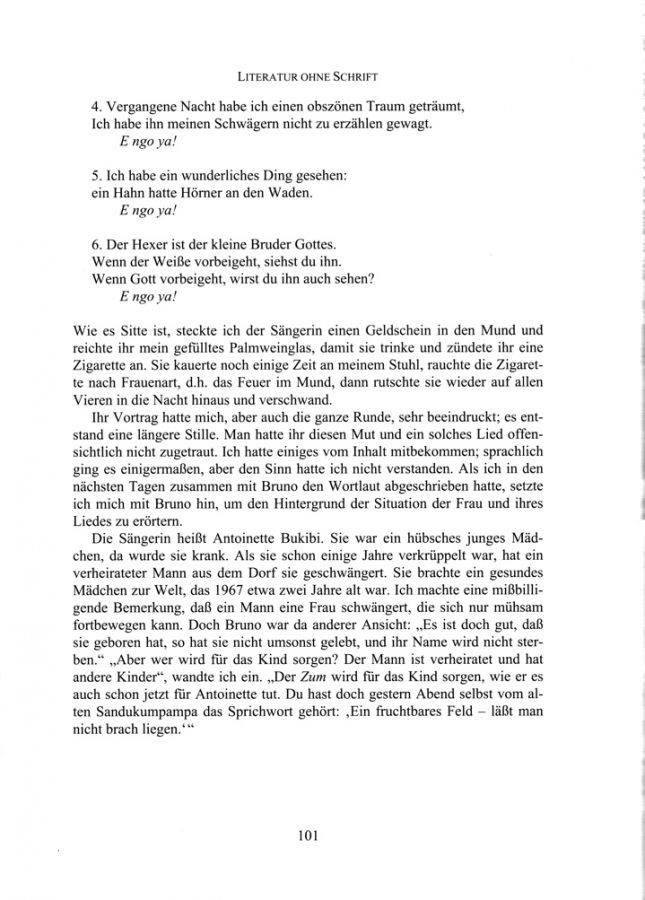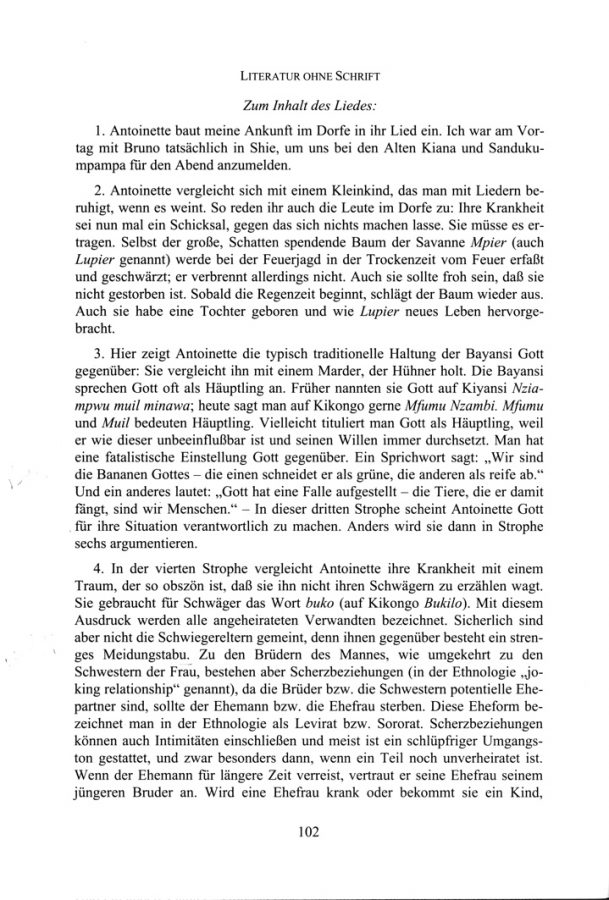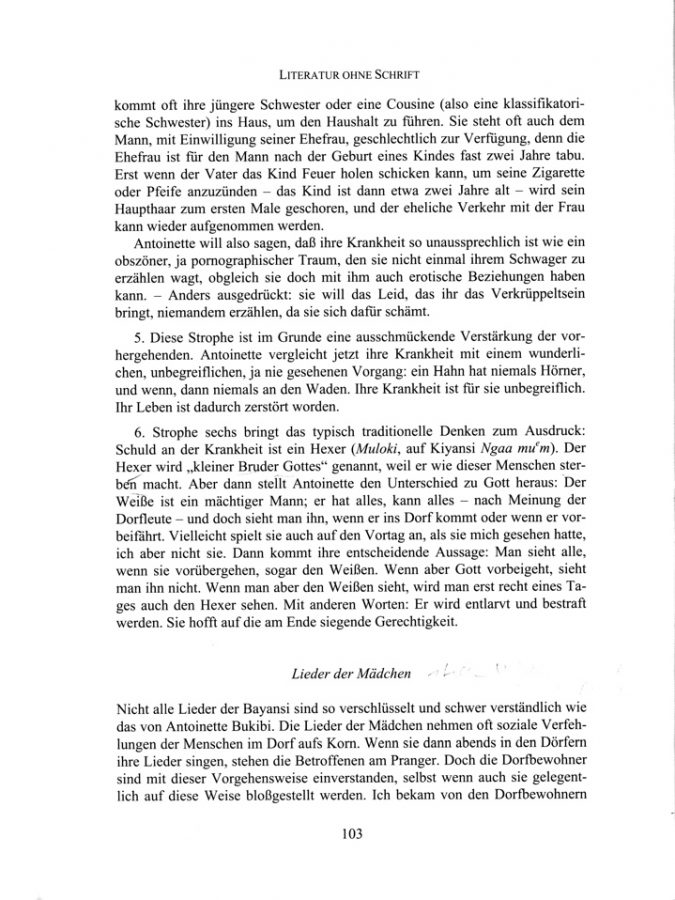Die Begegnung
Auf dem Markt begegne ich einer starken Figur, dem klassischen afrikanischen Krüppel, nicht einmal auf einem der Klapptische, sondern auf einer einfachen Decke am Boden, erschreckend naturalistisch, die eigene Erlebnisse in Erinnerung ruft, zugleich gute klassische Pende-Schnitzerei.
Die Materialien sind: Holz, über Holz gespannter Stoff, Rohr, Harz, frische Bananenstrohfrisur; alles zusammen 2kg schwer, 42 cm (mit Frisur 45) hoch, solider aufrechter Stand in realistischer Position.
Anfangs versuche ich den Verkäufer mit dem Hinweis auf Museen zu vertrösten, aber da bin ich noch nicht sicher, ob er auf dem Markt nicht noch einen ‚Kuriosa’-Liebhaber finden würde. An diesem Tag findet er ihn nicht. Ich kontaktiere ihn einige Tage später und erwerbe sie mit Herzklopfen.
Ich kann mit dieser Figur nicht ‚zusammenleben’ wie mit anderen – ich müsste ‚mein Leben ändern’ – aber ich kann sie ins Netz stellen und für ‚reale’ Hilfe werben lassen. Ich möchte mehr über sie wissen. Irgendwann muss sie in eine Institution.
Die Kraft der Figur
Der ästhetische Aspekt
 Der Künstler hat vor allem die entscheidenden Winkel von Händen und Füßen genial gestaltet.
Der Künstler hat vor allem die entscheidenden Winkel von Händen und Füßen genial gestaltet.  Immer wieder schaue ich ungläubig auf die durch Tücher und Harz verbundenen Bambusrohre. Die Winkel – auch die der starr gespreizten Finger und Zehen – sind ‚Realität’.
Immer wieder schaue ich ungläubig auf die durch Tücher und Harz verbundenen Bambusrohre. Die Winkel – auch die der starr gespreizten Finger und Zehen – sind ‚Realität’.
Danach frage ich mich gar nicht bei dem Oberkörper, der ein Hemd glaubhaft macht mittels des sich kantig durchdrückenden ‚Körpers’ aus Holz, wie anzunehmen ist. Und erst recht nicht bei einem Gesicht, das zugleich den ‚realistischen’ Ausdruck einer wiederholten physischen Anstrengung zeigt wie die typischen Gesichtstraditionen der nördlichen Pende-Masken.
Wie schrieb noch Rubin in ‚Primitivismus’:
„Der Künstler brauchte nur die traditionelle Stilisierung seines Volkes auf physische Phänomene zu übertragen. Picassos Verzerrungen waren hingegen eine erfundene Projektion…“ (274)
Und was ist nun ‚gewaltsamer’? Für mich immer noch die Realität. Ästhetik ist doch Schein, Schall und Rauch.
Die ästhetische Qualität des geschnitzten Gesichts rührt mich besonders. Keine Koketterie verwässert die Kraft der Tradition.
Ihre mobilisierende Kraft
Ein paar Tage später. Ihre Kraft erweist sich in meiner Spende für das Unicef-Programm. Zugegeben, ich habe mir zuvor den bewegenden Dokumentarfilm „Benda Bilili“ (Link zu Wikipedia) noch einmal angesehen und die Untertitel zweier Liedtexte der Bettler-Band aus Kinshasa kopiert.
Staff Benda Bilili. Papa Ricky ist der Vater der Straßenkids….
Einst schlief ich auf Kartons
Bingo, bald leist’ ich mir ’ne Matraze
Das kann auch dir passieren
Dir, ihm, euch
Ein Mann ist nie am ende
Das Glück kommt unverhofft
Es ist im Leben nie zu spät
Eines Tages werden wir es schaffen
Einst schlief ich auf Kartons ….
Niemandem steht es an andere zu verurteilen
Das Leben kommt und geht
Niemand steht es zu, ein Straßenkind zu verurteilen
Niemand sucht sich sein Leben aus
Die Kinder vom Mandela-Kreisel sind große Stars
Sie schlafen auf Kartons
Die Behinderten von Plateform sind große Stars
Sie schlafen auf Kartons
Wir haben Kartons!
Es steht dir nicht zu, mich auszulachen :/
Im Centre pour hébergement des handicapés physiques sinistrés in Kinshasa singt er:
Ich bin gesund geboren
Aber dann hat mich die Polio erwischt
Schau mich heute an, gefesselt an mein Dreirad
Ich laufe an Krücken
Bin zum Mann mit dem Krückstock geworden
Verfluchte Krücken
Welche Schinderei
Verantwortungsvolle Mütter
Gehen ins Impfzentrum
Und lassen ihre Babys impfen gegen Kinderlähmung
Hört ihr Eltern
Vernachlässigt eure Kinder nicht mehr
Das an Kinderlähmung leidet
Und das Unversehrte
Es besteht kein Unterschied zwischen beiden
Wer weiß, welches dir später hilft
Gott im Himmel
Ich erfinde nichts. Meine Lieder erzählen von meinem Leben. (12’)
Poliomyelitis
Dann google ich ‚Polio’ und gehe auf die entsprechende UNICEF-Seite.
Ich schäme mich – für meine Unwissenheit und meine soziale Härte. Solche Schicksale lassen sich verhindern, ohne dass wir selber ‚bluten’ müssen! Ich habe ja Zweifel, ob ‚Kinderleben’ in solchen Milieus auf jeden Fall ‚gerettet’ werden ‚müssen’, aber wenn das Kind überlebt, sollen ihm auch funktionstüchtige Gliedmaßen zur Verfügung stehen.
Ich bin an der Côte d’Ivoire solchen Bettlern begegnet. Sie haben mich schockiert. Mir tun auch ihre Ehefrauen leid und ihre Kinder, die sie immerhin ernähren können. Diese Ökonomie empfinde ich spontan als pervers, obschon es eine eigene ‚Humanität’ dieser Gesellschaften dokumentiert.
„Impfaufklärung von Tür zu Tür“ UNICEF
Ich zitiere Auszüge aus dem Bericht vom 13. Juli 2012 von Beatrix Hell „Impfaufklärung von Tür zu Tür“ – 2024 steht ein globaler UNICEF-Erfolgsbericht im Netz (LINK), der aber die Frage nach den „Hindernissen in der RDC“ nicht behandelt .
„ Hindernisse bei Impfaktionen
Schon ein Blick auf die Landkarte verdeutlicht es mir: In einem Land, das sechs bis sieben Mal größer ist als Deutschland, sind viele Regionen kaum zugänglich. (…) Jeder Medikamententransport ist aufwändig und kostspielig. Dies gilt vor allem für den sehr Hitze empfindlichen oralen Polio-Impfstoff. Aufgrund der Abgeschiedenheit vieler Dörfer ist es zudem schwierig, alle Bewohner über das medizinische Angebot zu informieren und zu Impfungen aufzurufen. Oft gibt es keine Elektrizität, kein Fernsehen oder Radio. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass auch kongolesische Eltern Sorge wegen schädlicher Impf-Nebenwirkungen haben.
Der Widerstand gegen eine Impfung basiert in manchen Regionen aber vor allem auf kulturellen und religiösen Vorbehalten. So predigt Marco Kiabuta, ein religiöser Führer in einem Dorf in Nord-Katanga: „Wir brauchen keine Impfung, weil wir nur einen Doktor haben und das ist Gott.“
Um die Impfbereitschaft zu erhöhen, setzen UNICEF und seine Partner verstärkt auf Aufklärung. Dafür arbeitet UNICEF mit Hilfsorganisationen, lokalen Initiativen und Gemeinden zusammen und bietet Schulungen an. Auch traditionelle und religiöse Führer wie Dorfchefs und Priester werden zur Mitarbeit gewonnen. Denn gerade sie haben aufgrund ihrer Anerkennung als Autorität einen leichteren Zugang zur Bevölkerung. Ihren Worten wird Glauben geschenkt. Am wirkungsvollsten hat sich die Kommunikation im persönlichen Kontakt bewiesen. Geschulte Gemeindemitarbeiter, Gesundheits- und Impfhelfer gehen als so genannte „Mobilizer“ von Tü̈r zu Tü̈r, von Familie zu Familie und klären über die Gefahr und den Schutz vor Kinderlähmung auf….
Die Darstellung klingt – auf jeden Fall im Original – konventionell. Vor allem politische und soziale Probleme werden nach Art von Hilfswerken eben nur angedeutet.
In die Welt solcher Krankheitsdarstellungen
Die Frage nach der möglichen Verwendung lässt mich nicht los. Der Verkäufer winkt ab. Die Figur ist durch zu viele Hände gegangen.
Ich stelle mir vor: Wenn Gesundheitshelfer durch die Dörfer gehen, wie UNICEF berichtet, könnte eine solche Figur sie unterstützt haben.
Der ‚traditionelle’ afrikanische Deutungshorizont
Ich lese bei Herreman: To Cure and Protect, p.19 „Many objects which show disease are used to caution against anti-social behavior. … representations of the negative forces or malevolent spirits that are activated when moral values are transgressed.“
(„Viele Objekte, die Krankheiten darstellen, werden benutzt, um vor unsozialem Verhalten zu warnen. Es handelt sich um Darstellungen der negativen Mächte oder hasserfüllten/bösen Geister, die vom Verstoß gegen moralische Werte aktiviert werden.“)
Also wären die Opfer selber verantwortlich für die schwere Krankheit, die sie geschlagen hat. Ist das vielleicht ein Motiv dafür, dass sich Älteste gegen Impfungen wehren, eine Drohung aus der Hand zu geben.
Eine Anekdote
18.August
Telefongespräch mit Joseph Thiel, dem früheren Direktor des Weltkulturenmuseums in Frankfurt. Er ist wieder einmal von sagenhafter Ausgeglichenheit.
Er sagt, die Schlafkrankheit stehe im Vordergrund des Interesses der Leute. Er erzählt von den medizinischen Trupps, die kommen, um Schwellungen an den Ganglien zu entdecken. Auf dieser 1.Stufe ist die Schlafkrankheit noch mit Spritzen zu behandeln. Doch seit der Unabhängigkeit gibt es kaum noch Stationen und erst recht keine Medikamente.
(Ich beschreibe die Figur.) Ja Pende, das ist typisch für sie. Sie zeigen die Krankheiten – die andere verstecken – weil sie das alltägliche Leben ganz konkret darstellen. Er kommt auf stark verzerrte Krankheitsmasken zu sprechen. Sie tanzen sie.
Ich: aber was ist mit Figuren?
Er weiß es nicht genau: tanzen oder aufstellen zu bestimmten Zeiten. Von der Verwendung durch Heiler hat er noch nichts gehört. Kommt auf die Literatur zu sprechen, erinnert sich an eine Abbildung, kann sie aber nicht wiederfinden.
Ich sage: die Figur ist solide, ich schätze sie ein halbes Jahrhundert alt.
Er: Es kann auch ein ganzes sein.
Sein Verhältnis zur Welt der Geister, Masken und Figuren ist entspannt.
Als er 1971 das letzte Mal im Kongo war, in den Dörfern ‚seiner’ Yanzi, entfernten Nachbarn der Pende flussabwärts in der Provinz Bandundu, saß er abends mit den Alten zusammen, als eine junge, ehemals schöne Frau herein gekrochen kam. Natürlich nach Ansicht der Leute verhext und von bösen Geistern befallen.
Er erfuhr bei der Gelegenheit, dass sie auch noch von einem verheiraten Mann geschwängert worden sei.
Er zeigte sich zumindest überrascht: Das geht doch nicht, sie kann sich so doch gar nicht um das Kleine kümmern, das muss dann die Großmutter machen!
Antwort der Alten: Man kann doch einen fruchtbaren Acker nicht brach liegen lassen.
9. September
„Der fruchtbare Schoß“
Dem Argument des „fruchtbaren Ackers“ begegne ich – ohne die Metapher – in der Einleitung von Zoé Strother „Inventing Masks“ (1998,1999, p.3) wieder. Sie berichtet ein Vorkommnis aus den Jahren 1963-65, als auf eine eng begrenzte Rebellion von Pende gegen das neue Regime in Kinshasa als Repressalie Soldaten zahlreiche Dörfer im Pendeland plünderten und in Brand steckten. Damals entledigte sich eine junge Mutter auf der Flucht in höchster Bedrängnis ihres kleines Sohns und entkam den Soldaten. Den Bub konnte sie danach unverletzt auflesen und zur Familie zurückkehren. Später musste sie sich öffentlich vor den Ältesten rechtfertigen und brachte ungewöhnlich selbstbewusst zu ihrer Verteidigung vor:
„Hätte ich als fruchtbare Frau mein Leben riskieren sollen, um einen kleinen Jungen zu verteidigen … einen Jungen, der nie auch nur eine Person zu dieser Familie hinzufügen wird?“ (lineage) Die Pende sind mutterrechtlich organisiert, und Frauen werfen es ihren Ehemännern manchmal vor, wenn sie nur Söhne und keine Töchter gebären.
Unser Thema ist aber nur: Die Fruchtbarkeit von Frauen bedeutet sozial selbstredend Gebärzwang. Der steht natürlich im engen Zusammenhang mit Pflichten einer ‚Mutter‘, wie sie mir bereits aus dem Buch „Catastrophe and Creation“ von Kejsa Ekholm Friedman her bekannt sind (Link auf: „Weiterleben am Kongo…„, dort der Abschnitt: ‚Pflichten einer Frau‘). Daher war das Dorf über die Antwort der jungen Frau natürlich hoch empört. Doch gegen ihr Argument kamen auch die Ältesten nicht an.
„Sie benutzen uns wie Bruthennen …“
taz 4.4.2012 Reportage aus dem Nordostkongo, Distrikt Dungu, im Rebellengebiet (von Joseph Kony und seiner LRA. 
Zunächst fällt mir dieses Foto ins Auge. In höchster Bedrängnis ließ die Familie den gelähmten Jungen im Dorf zurück. Auch er wurde wie der Pende-Knabe. später – das beweist das Foto – unverletzt gefunden
Was das Bild wohl an Gedanken und Emotionen bei den europäischen Betrachter ausgelöst hat?
Schlimmer erging es der jungen Mutter, von der am Ende der Reportage die Rede ist. Sie wurde 2012 von der Reporterin Simone Schlindwein in einem Lager der UNHCR interviewt . 2008 war sie mit hunderten von Klassenkameradinnen aus ihrer Schule entführt und versklavt worden. „Sie haben uns wie Sklaven an einem Seil aneinander gebunden und in den Busch gezerrt.“ Die geschlechtsreifen Mädchen wurden den Kämpfern als Frauen gegeben. Sie wurde einem ugandischen Kämpfer zugeteilt und gebar zehn Monate später ihren Sohn. „Sie benutzen uns wie Bruthennen, um ihre Kinder zu gebären“.
2. November
„Das Lied der Antoinette Bukibi“
Endlich kommen ich dazu, das Buch von Josef Franz Thiel zu lesen:
„Jahre im Kongo – Missionar und Ethnologe bei den Bayansi“, 58 Fotos, 2 Karten, Frankfurt am Main 2001. Vergriffen. Wenige Angebote im Netz zwischen 165 und 3 Euro (1.11.17)
Ein einzigartiges Buch: Einführung in ethnologisches Denken, Feldstudie und Forschungsbericht (zwischen 1961 und 1971), Tätigkeitsbericht, Analyse des institutionellen Rahmens katholischer Heidenmission im 20. Jahrhundert, Autobiografie – unprätentiös und über weite Strecken unterhaltsam wie ein Schmöker. (Ich sage so etwas ganz selten!)
Für meine Webseite kann es wichtig werden als Folie, die alle möglichen Aspekte der Gesellschaft und des Denkens der Völker Zentralafrikas verbindet.
Im Kapitel „Literatur ohne Schrift“ auf den Seiten 100 bis 103 begegnet uns die verkrüppelte Frau Antoinette Bukibi, die in einer geselligen dörflichen Runde ihr Lied in traditionellem Stil vorträgt. Sie erregt als Sängerin bei den Anwesenden Erstaunen. Der Autor transkribiert, übersetzt und interpretiert den Text in den nächsten Tagen mit der Hilfe seines lokalen Assistenten. Dabei kommt nicht nur die Poetik der Bayansi zur Sprache und ihre Umformung alltäglicher Realitäten, auch steht Antoinette Bukibi in ihrem Leid und ihrem Stolz unverkürzt vor uns.
Das verbindet sie mit Papa Ricky von Staff Benda Bilili, hebt aber ihre Dichtung in meinen Augen über das Lied des Straßensängers in Kinshasa hinaus.
Die Auffassungen der Yansi zum Leben im Allgemeinen und zu Frauen im Besonderen kommen auch nicht mehr so holzschnitthaft und skandalös daher wie in der mündlichen Mitteilung. Wir werden uns ihnen behutsamer nähern müssen. Menschlichkeit tritt auf der Bühne der Geschichte in den kuriosesten Verkleidungen auf. Schauen wir nur einmal auf die eigene Umgebung.
P.S.
Auch über den Kontext der Figur könnte in der nächsten Zeit noch etwas mehr zu sagen sein, doch wegen der Übersichtlichkeit lieber in einem eigenen Beitrag