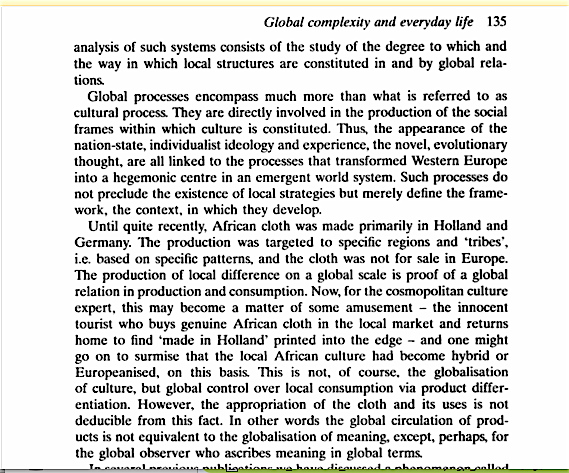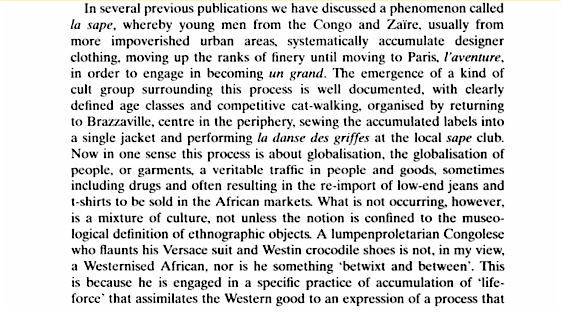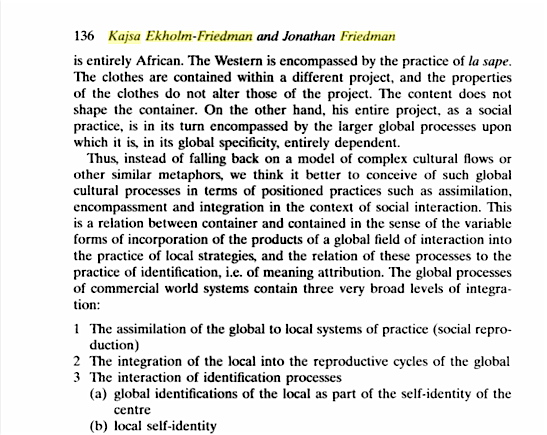Kajsa Ekholm-Friedman Darstellung der Transformationen der Gesellschaften am Kongo, sowohl durch den Atlantikhandel wie durch die Kolonisierung. Deshalb interessieren mich ihre grundsätzlichen Überlegungen zu ‚Einfluss‘ und ‚Aneignung‘ im Sammelband Worlds-Apart-Modernity-Through-the-Prism-of-the-Local, den Daniel Miller 1995 herausgegeben hat.
Globale Komplexität im Alltag am Beispiel ‚Mode‘
Globale Prozesse greifen direkt in die Rahmenbedingungen ein, in welchen Kultur entsteht. Sie schließen lokale Strategien nicht aus, sie definieren nur den Rahmen, den Kontext, worin sie sich entwickeln.Bis vor kurzem wurde afrikanische Stoffe hauptsächlich in Holland und Deutschland produziert. Die Produktion zielte auf bestimmte Regionen und ‚tribes‘ und war in Europa nicht zu kaufen. Dies ist ein Beispiel für globale Kontrolle über den lokalen Konsum via Produktdifferenzierung. Doch lässt sich aus dieser Tatsache die Aneignung und der Gebrauch der Stoffenicht deduzieren. Die globale Warenzirkulation ist nicht gleichbedeutend mit einer Globalisierung von Bedeutung, außer vielleicht für (in ihrem Kopf, Gv) Bedeutung verallgemeinernde Beobachter. (Was beobachten diese?)
Diese Beobachtung der Ekholm-Friedman’s ist einleuchtend; sie hat bereits in die Analyse der „Massenindividualisierung in der Mode“ auf der Konsumentenebene Eingang gefunden ( so: Mentges/Richard: „Schönheit der Uniformität – Körper, Kleidung, Medien“, Campus Frankfurt 2005). Sie kommt am Beispiel des Modekults la sape in Kinshasa gut zur Darstellung.
Übersetzung der Seiten 135/136
Junge Männer aus dem Kongo, gewöhnlich aus stärker verarmten städtischen Bezirken häufen systematisch Designerklamotten an, wobei sich auf der Skala der Verfeinerung bis nach Paris bewegen, l’aventure /wie Parzival eine ritterliche ‚Aventüre‘ unternehmen, Gv/ in der Absicht, un grand, ein #Grande‘ zu werden. Die Entstehung einer Kultgemeinschaft um diese Vorgänge ist gut dokumentiert, mit klar definierten Altersklassen und Auftritten mit Wettbewerbscharakter bei der Rückkehr nach Brazzaville (oder Kinshasa, Gv), dem Zentrum in der Peripherie, wobei sie die gesammelten Labels eigens auf ein Jackett nähen und den danse des griffes, den ‚Krallentanz‘, im lokalen sape-Club tanzen.
Die Autoren betonen, dass es dabei in einer Hinsicht um Globalisierung geht, einen Verkehr von Menschen und Gütern, eingeschlossen Drogen und der Re-Import gebrauchter Kleider für die lokalen afrikanischen Märkte. Doch handelt es sich keineswegs um eine ‚Vermischung‘ von Kulturen. Ein lumpenproletarischer Kongolese, der mit seinem Versace-Anzug und mit Westin Krokodilschuhen protzt, ist kein verwestlichter Afrikaner, noch etwas ‚dazwischen‘. Denn er ist in einer bestimmten Praxis der Akkumulierung von ‚Lebensenergie‘ engagiert, der das ‚westliche‘ Konsumgut zu einem Ausdruck eines Prozesses werden lässt, der voll und ganz ‚afrikanisch‘ ist. (135/136)
KERNTHESE:
Das Westliche wird von der Praxis der sapeurs völlig eingenommen. Auch im (anderen Fall des traditionellen Handels mit Europa) sind die Stoffe Teil eines gänzlich verschiedenen Projekts, seine Eigenschaften verändern nicht die des Projekts. Der Inhalt formt nicht den Container. Das Projekt ist aber seinerseits wieder von größeren globalen Prozessen abhängig.
Statt auf ein Modell komplexer kultureller Ströme oder ähnlicher Metaphern zurückzufallen, sollte man solchen globalen kulturellen Prozesse besser in Begriffen solcher positionierter Praktiken wie Assimilierung, Einschluss und Integration fassen … (136)

ARTE Kleider und Leute: ‚Eine Kenzo-Jacke verbrennen, der Gipfel des Spleen ‚ – Etwa eine zu oberflächliche Sicht?
Originaltext:
Nicht mehr als ein Fingerzeig!
Ganz glücklich machen mich diese Ausführungen dann doch nicht. Zuerst störte mich die todernste theoretische Argumentation zur Fundierungen von Erkenntnissen, die so neu nicht sein können, außer für einen Diskurs zwischen Doktrinen. Feldforscher wie Frank Willett haben seit 1971 auf die gängige Praxis hingewiesen, nicht allein fremde Objekte zuzukaufen, sondern auch attraktive Kulte der Nachbarn ganz zu übernehmen und einzugemeinden. Märkte funktionierten ohnehin so, dass aus dem Angebot eine subjektive Auswahl getroffen wurde. Ich entnehme dem Text zweierlei: 1. Hüte dich vor dem Eigenleben plakativer Metaphern 2. Halte die Augen offen und höre nie auf, konkrete Fragen zu stellen.
Die beiden gewählten Beispiele sind vor allem Türöffner für weitere Untersuchungen. Was etwa die schweren Indigo-Batiken ‚Adire Eleko‘ der Yoruba angeht, würde ich sie unter die ‚Prestigegüter‘ einordnen, die Designerklamotten aber auch als so etwas ansehen. Der ‚Kult‘ in den Vorstädten von Kinshasa macht, dem Filmfeature nach zu urteilen, gute Stimmung, gibt jungen Männern eine Bühne und ist ein Aspekt des ‚Savoir vivre‘ der ansonsten gebeutelten Städter. Für mich ist das nicht ‚exotischer‘ oder erklärungsbedürftiger als die mich umgebende urbane Konsumwelt. Sogar in gewissem Sinn rationaler. Denn mit welchem Recht spielen und feiern sich die Individuen in den reichen Gesellschaften zu Tode? Der Hinweis der Autorin auf den Dienst an spirituellen „Lebensenergien“ am Kongo ist auch ‚kongolesisch‘ gedacht, aber tut er nicht des Guten zuviel?
„CONGO FASHION WEEK – La mode internationale au coeur de l’Afrique“

«Congo Fashion Week» du 07 -10 oct 15 Kinshasa lecongolais.cd – Gefäß oder Inhalt? > youtube 2014
Vielleicht müssen die Europäer sich erst als Afrikaner entdecken, um die Menschheit als eine Spezies zu akzeptieren. Und was bleibt dann von der Verschiedenheit ihrer lokalen kulturellen Ausprägungen? Wahrscheinlich wird die schon theoretisch weit überschätzt!
Ich weiß noch nicht, wohin dieser Beitrag sich entwickelt. Michael Oppitz betont jedenfalls die Einbettung von ‚Mythen‘ in die Lebensumstände und ihre Offenheit gegenüber individueller Auslegung. Till Förster, Basel fragt, wer denn überhaupt zur Interpretation von lebendiger ‚Kultur‘ befugt sei, warum nicht jeder, der irgendein Teil von ihr ist? Alles andere wäre doch museal.